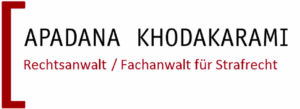Der 1. Senat hat in dem Urteil BGH StR 576/16 die Grundsätze des Täter-Opfer-Ausgleichs nach § 46a StGB erörtert. Die Angeklagte, die auf den Geschädigten mit einem Messer eingestochen hatte, war geständig, hatte an das Opfer Briefe geschrieben, sich entschuldigt und monatlich 80 Euro aus ihrem Verdienst in der Untersuchungshaft an den Geschädigten gezahlt, insgesamt 420 Euro. Der Geschädigte hatte das Geld und auch die Entschuldigung in der Hauptverhandlung angenommen, obwohl ihm das nach eigenem Bekunden schwer gefallen sei. Die Revision der Staatsanwaltschaft hatte sich ohne Erfolg gegen die Annahme eines Täter-Opfer-Ausgleichs gewandt:
„§ 46a Nr. 1 StGB setzt voraus, dass der Täter in dem Bemühen, einen Ausgleich mit dem Opfer zu erreichen, die Tat ganz oder zum überwiegenden Teil wiedergutmacht oder dieses Ziel jedenfalls ernsthaft erstrebt hat. Dies erfordert grundsätzlich einen kommunikativen Prozess zwischen Täter und Opfer, bei dem das Bemühen des Täters Ausdruck der Übernahme von Verantwortung sein und das Opfer die Leistung des Täters als friedensstiftenden Ausgleich akzeptieren muss. Die Wiedergutmachung muss auf einen umfassenden Ausgleich der durch die Straftat verursachten Folgen gerichtet sein (…).
b) Gemessen daran hat das Landgericht rechtsfehlerfrei die Voraussetzungen des § 46a Nr. 1 StGB bejaht. Entgegen der Ansicht der Revision hat die Angeklagte im Rahmen ihres Geständnisses die Verantwortung für die Tat uneingeschränkt übernommen. Dass sie – ebenso wie der Geschädigte – keine konkrete Erinnerung an das unmittelbare Tatgeschehen hatte, ändert daran nichts. Der Umstand, dass die Angeklagte bestritten hat, dass sie die Videokamera, die das Tatgeschehen (visuell) hätte aufzeichnen können, vor der Tatbegehung gezielt umgestoßen hat, lässt ihre Verantwortungsübernahme für die Tat nicht entfallen. Sie hat nämlich das Tatgeschehen gleichwohl eingeräumt und somit ihr Tun und die daraus resultierenden Folgen nicht in Abrede gestellt, insbesondere aber auch nicht die „Opfer-Position“ des Geschädigten bestritten (…).
c) Dem Urteil ist zudem hinreichend zu entnehmen, dass zwischen der Angeklagten und dem Geschädigten ein kommunikativer Prozess während ihrer Untersuchungshaft begonnen wurde. Sie hat in dem an den Geschädigten gerichteten Entschuldigungsschreiben die Verantwortung für die Tat übernommen und dies in der Hauptverhandlung wiederholt. Der Geschädigte hat die Entschuldigung – ebenso wie den von der Angeklagten angesparten und überreichten Geldbetrag – auch angenommen. Die Ansicht der Revision, der Geschädigte habe die Entschuldigung und den Geldbetrag nicht als friedensstiftenden Ausgleich angesehen, weil er das Geld ohne „weitere Erklärung entgegen“ genommen habe und es ihm auch schwer gefallen sei, die Entschuldigung zu akzeptieren, stellt lediglich eine eigene, revisionsrechtlich unbeachtliche Bewertung der friedensstiftenden Wirkung – wie sie vom Tatgericht angenommen wurde – dar. Weitergehender Ausführungen des Landgerichts hierzu bedurfte es vorliegend nicht.
Schließlich hat das Landgericht die geleistete Zahlung der Angeklagten ohne Rechtsfehler als ernsthaftes Erstreben einer Wiedergutmachung bewertet. Es hat dabei zutreffend darauf abgestellt, dass der Geldbetrag zwar objektiv nicht hoch genug sei, um ihn als überwiegende Wiedergutmachung des immateriellen Schadens anzusehen. Jedoch sei der Betrag gemessen an den finanziellen Möglichkeiten der Angeklagten eine ganz erhebliche Leistung, die ihren Wiedergutmachungswillen belege.